Das Virus
Die Maul- und Klauenseuche (MKS) ist eine Viruserkrankung der Paarhufer (Rinder, Schafe, Ziegen, Rehe, Rotwild, Damwild, Schweine, Wildschweine)1,2,3,4,5.
Sie kommt sowohl bei Nutz- als auch bei Zoo- und Wildtieren vor1.
Das Virus gehört zu der Familie der Picornaviren (= kleine Viren) und bildet die eigene Gattung Aphthovirus . Es wird übertragen durch direkten Kontakt oder auch durch Aufnahme aus der Umgebung, z. B. über kontaminiertes Futter1,2,3,4,5.
In verschiedenen Ländern und Kontinenten wurden unterschiedliche Untergruppen (Serotypen) des Virus entdeckt, die teilweise voneinander abweichende Eigenschaften haben in Bezug auf Übertragbarkeit (Virulenz) und Überlebensfähigkeit (Tenazität)1,6,7,8.
Die Typen A, B und C, wurden zuerst in Europa nachgewiesen.
Die Typen SAT 1, SAT 2 und SAT 3 im Süden Afrikas (SAT = Southern African Territories)
Der Typ Asia 1 in Asien.
Jeder Serotyp hat noch weitere Untertypen.
Das Virus ist weltweit verbreitet, mit Ausnahme einiger Inseln, wie Neuseeland und Australien1,4,6,7,8.
Die jeweilige örtlich begrenzte (endemische) Verbreitung sowie aktuelle Ausbrüche der Maul- und Klauenseuche werden von der Welttiergesundheitsorganisation (WOAH = World Organization for Animal Health - entspricht für Tiere in etwa der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Menschen) auf ihrer WAHIS-Webseite veröffentlicht. Sowie auf der Webseite des Weltreferenzlabors für MKS in Pirbright, Großbritannien9,10,11.
MKS-Viren besitzen eine große Widerstandsfähigkeit (Tenazität) und können daher auch außerhalb des Körpers für längere Zeit überleben. Sie werden z.B. über Gerätschaften (Mistgabel, Futtereimer) als auch über Matsch, der an Stiefeln oder Autoreifen anhaftet von einem Tier zum anderen, von einem Stall zum anderen oder von einem Hof in die Umgebung (Feld, Wald) übertragen. Auch andere, nicht empfängliche Tierarten wie Pferde, oder Hunde und Katzen können das Virus weitertragen. So kann sich das Virus unbemerkt und recht schnell weiter verbreiten und eine Reihe von Tierarten und Einzeltieren befallen. Auch eine Übertragung durch die Milch ist möglich.
Meist wird das Virus über die Schleimhäute von Nase und Maul aufgenommen.
Seine Bedeutung liegt in den wirtschaftlichen Schäden, die ein MKS-Ausbruch nach sich zieht1,5,7.
Entdeckt wurde das Virus von Friedrich Loeffler, einem Mitarbeiter Robert Kochs12.
Während Ersterer Namensgeber des Robert-Koch Institutes (RKI) ist, einer Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesgesundheitsministeriums (BGM), wird Loefflers Arbeit durch die Benennung des Friedrich-Loeffler-Institutes (FLI), einer Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) wertgeschätzt1,12,13,14.
Das FLI ist das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit und übernimmt damit vergleichbare Aufgaben für Tiere wie das RKI für die Bevölkerung13.
Dazu findet sich auf der Webseite des FLI folgende Notiz:
„Das Friedrich-Loeffler-Institut wurde von seinem Namensgeber zur Erforschung der MKS gegründet und nahm 1910 seine Arbeit auf. Seitdem ist diese Tierseuche fester Bestandteil der Forschungsarbeiten.“15.
Symptome
Die Krankheit äußert sich - je nach Tierart - unterschiedlich. Die häufigsten Symptome sind Bläßchenbildung (sog. Aphthen: griechisch ‚aphtha‘ Bläschen, Mundschwämmchen - „Sie sind isoliert stehende, scharf begrenzte, kreisrunde oder ovale, gewöhnlich etwa 2 - 5 mm im Durchmesser große, von einem lebhaften roten Saum umgebene, schmerzhafte Schleimhautdefekte.“) an der Zunge und der Maulschleimhaut, im Zwischenzehenspalt und an den Zitzen.1,5,7,16,17+Photos.
Diese Aphthen führen zu Schmerzen beim Laufen und bei der Futteraufnahme. Insbesondere, wenn sie aufgeplatzt sind.
In der Aphtenflüssigkeit vermehrt sich das Virus. Wenn sie schließlich aufplatzen wird infektiöses Virus frei und kann so auf andere Tiere und Gegenstände übertragen werden.
Das Virus der Maul- und Klauenseuche verbreitet sich ebenfalls über die Milch, den Speichel, Urin und Kot infizierter Tiere und mit dem Wind1,2,3,4,5.
Sowie über das Fell anderer Tiere wie Hunde, Katzen, Pferde, Ratten, Mäuse1.
Die Krankheit führt nicht unbedingt um Tode, aber zu einer deutlichen Abmagerung der Tiere. Bei den landwirtschaftlichen Nutztieren ist die Folge ein deutlicher Einbruch in der Milch- und Fleischproduktion. Das Resultat sind große wirtschaftliche Verluste der betroffenen Betriebe1,7.
Die folgenden Photos stammen aus der „lesion library“ der European Commission for the Control of Foot-and-Mouth Disease - EUFMD (= Europäische Kommission zur Kontrolle der Maul- und Klauenseuche)18.
Zoonosegefahr?
Laut FLI ist das Virus auf den Menschen nicht übertragbar. Es besteht also keine Zoonosegefahr2.
Allerdings beschreiben Beer und Thalmann (1987):“Desgleichen ist der Mensch nur sehr gering empfänglich für das MKS-Virus, wenngleich wohl während jedes größeren Seuchenzuges einzelne Krankheitsfälle bekannt geworden sind. Einhufer erkranken nicht.“1.
Weitere Tierarten, von denen sporadisch Infektionen mit dem Maul- und Klauenseuchevirus berichtet werden, sind Elephanten, Hund, Katze, Kaninchen, Ratte und Igel1.
Auf der Webseite des zuständigen Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft heißt es in einer Pressemitteilung vom 10. Januar 2025:
„Obwohl die MKS eine hochkontagiöse Viruskrankheit ist, sind Infektionen des Menschen außerordentlich selten, da der Mensch nur wenig empfänglich ist.“19.
Hier sind sich also nicht mal Ministerium und weisungsgebundene Bundesoberbehörde einig.
Die Verordnung zum Schutz gegen die Maul- und Klauenseuche (MKS-Verordnung)20 listet als „Tiere empfänglicher Arten: Tiere der Unterordnung Wiederkäuer (Ruminantia), Schweine (Suina) und Schwielensohler (Tylopoda) der Ordnung Paarhufer (Artiodactyla).“
Die Welttiergesundheitsorganisation (WOAH - woah.org) definiert in ihrem Terrestrial Animal Health Code21 folgende Tiere als empfänglich für das MKS Virus:
- Tiere der Familie Suidae
- Tiere der Subfamilien Boviae, Caprinae und Antilopinae der Familie Bovidae und Cervidae (im folgenden Wiederkäuer)
- Camelus bactrianus.
Schon hier gibt es also Widersprüche.
Widerstandsfähigkeit und mühelose Verbreitung des Virus sind Ursache der umfassenden tierseuchenrechtlichen Maßnahmen, die im Falle eines Ausbruchsgeschehens gesetzlich verordnet sind.
Tierseuchenrecht
In der Europäischen Union (EU) regeln zwei Verordnungen die Prävention und Bekämpfung von Tierseuchenausbrüchen. EU Verordnungen sind in den Mitgliedsstaaten unmittelbar geltendes Recht22,23. Inwieweit dies gleichzeitig eine Ausschaltung nationalstaatlicher Souveränität und Demokratie bedeutet bleibt zu bedenken.
Hier beschränken wir uns auf das deutsche Tiergesundheitsgesetz und die dazu erlassene MKS-Verordnung (Verordnung zum Schutz gegen die Maul- und Klauenseuche - MKS-Verordnung, MKS-VO)20,24.
Die MKS-Verordnung unterscheidet zwischen dem Verdacht auf Maul- und Klauenseuche und dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche.
Zur Feststellung des Verdachtes auf Maul- und Klauenseuche gelten folgende Anforderungen:
Verdacht auf Maul- und Klauenseuche [liegt vor], wenn das Ergebnis
- der klinischen
- der pathologisch-anatomischen
- der labordiagnostischen
Untersuchung den Ausbruch der Maul- und Klauenseuche befürchten läßt.“20.
Es kann also auch ohne direkten Nachweis des Erregers (MKS-Virus) und lediglich aufgrund des Auftretens MKS-typischer Symptome ein Verdacht auf das Vorliegen der Maul- und Klauenseuche geäußert und der zuständigen Behörde, d.h. dem Veterinäramt des Kreises, in dem sich das verdächtige Tier befindet, angezeigt werden. Diese leitet dann die weiteren Schritte ein, um den Verdacht zu erhärten oder auszuräumen und die mögliche Verbreitung des Virus einzudämmen20,24.
Dazu kann die zuständige Behörde um den Verdachtsbetrieb für längstens 72 Stunden eine Kontrollzone festlegen und einen kompletten ‚stand still‘ für diesen Betrieb anordnen, d.h. weder Tiere empfänglicher und nicht-empfänglicher Arten noch tierische Produkte empfänglicher Arten (Fleisch, Milch, Samen, Embryos) dürfen aus dem Verdachtsbetrieb heraus oder in den Verdachtsbetrieb hinein verbracht werden. Zufahrtswege können eingeschränkt und gesperrt werden. Der Verdachtsbetrieb ist zu kennzeichnen, Desinfektionsschleusen sind an Zu- und Abfahrten anzubringen, der Zugang für betriebsfremde Personen ist eingeschränkt und bedarf der schriftlichen Genehmigung. Der gesamte Tierbestand empfänglicher Arten sowie ihrer Produkte, Futtermittel, Einstreu, verendete Tiere ist täglich zu zählen und zu notieren. Diese Maßnahmen können auf weitere Betriebe ausgedehnt werden, wenn die Seuchenlage dies erfordert.
Im Falle der amtlichen Feststellung der Maul- und Klauenseuche aufgrund der Ergebnisse von virologischen, klinischen und / oder serologischen Untersuchungen, werden der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche von der zuständigen Behörde sowie der mutmaßliche Zeitpunkt der Einschleppung in den nun bestätigten Seuchenbetrieb
öffentlich bekannt gemacht. Des weiteren wird die zuständige EU Behörde von dem Ausbruch einer ansteckenden Tierseuche im Mitgliedstaat Deutschland informiert25. Eine weitere Meldung ergeht an die Welttiergesundheitsorganisation (WOAH)11,26,27.
Im Gegensatz zum Verdachtsfall, der laut MKS-Verordnung nur bei ‚empfänglichen Tieren‘ ausgesprochen werden kann, liegt ein Ausbruch der Maul- und Klauenseuche auch dann vor (MKS-VO §1(1)), wenn:
„bei einem Tier, in dessen unmittelbarer Umgebung oder einem Erzeugnis eines Tieres das Virus der Maul- und Klauenseuche Festgestellt worden ist, …“20.
Konkret kann also auch in einem Reitbetrieb ohne jegliche Paarhufer oder in einer Fleischerei ein MKS-Ausbruch festgestellt werden, mit allen daraus folgenden Konsequenzen der Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Tier und Mensch und der Vernichtung von Lebensmitteln tierischen Ursprungs. …
Die sofortige Tötung und unschädliche Beseitigung der empfänglichen Tiere des Ausbruchsbetriebes wird angeordnet, soweit dies nicht schon im Rahmen der ersten Ergebnisse der Verdachtsuntersuchungen geschehen ist20.
Alle tierischen Produkte, die seit der mutmaßlichen Einschleppung der Seuche im Seuchenbetrieb bis zur amtlichen Feststellung gewonnen wurden sowie Futtermittel und Einstreu müssen auf amtliche Anordnung unschädlich beseitigt werden. Reinigung und Desinfektion von Gegenständen, Fahrzeugen und Gebäuden sowie die Entwesung der Ställe sind vorzunehmen20.
Ausnahmeregelungen sind möglich für Untersuchungseinrichtungen, Zoos und Wildparks.
Die zuständige Behörde legt um den Seuchenbetrieb einen Sperrbezirk mit einem Durchmesser von mindestens 3 km fest, der geographische Gegebenheiten sowie die Ergebnisse epidemiologischer Untersuchungen berücksichtigt20.
Alle tierhaltenden landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland sind im Tierseuchennachrichtensystem (TSN) mit einer Betriebsnummer und den geographischen Daten registriert28. TSN wurde vom FLI entwickelt und wird vom FLI deutschlandweit verwaltet. Jeder Kreisveterinär hat Zugriff auf die TSN-Daten seines Zuständigkeitsbereiches, d.h. Kreises oder kreisfreien Stadt, der geographisch etwa der N3-Ebene entspricht20,28,29,30.
Die TSN-Datenbank koppelt die Betriebsnummer inklusive Standort mit der HIT-Datenbank (Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere), in der alle landwirtschaftlichen Nutztiere und Pferde eines Landkreises mit einer Identifikationsnummer (Ohrmarke, Mikrochip) gespeichert sind. (Wer jetzt an die für alle EU Bürger geplante ID2020 denkt, mag nicht ganz falsch liegen…).
Werden Tiere aus einem Betrieb hinaus oder in einen Betrieb hinein verbracht, so hat der Landwirt dies innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne (meist eine Woche) in der HIT-Datenbank zu vermerken. Auch hier hat der zuständige Amtsveterinär Zugriff auf die HIT-Datenbanken der Betriebe seinen Kreises31.
Zugriff auf TSN und HIT erlaubt es, die Bewegungen von Tieren in den Seuchenbetrieb hinein und aus dem Seuchenbetrieb heraus, nachzuvollziehen. Diese Daten werden im Rahmen der epidemiologischen Untersuchungen zur Feststellung der Herkunft und der Weiterverbreitung der Seuche erhoben (tracing back und tracing forward). So werden weitere betroffene Betriebe, Viehhandlungen, Auktionshallen und Schlachthöfe identifiziert. Diese können sich im selben Kreis, und Nachbarkreisen oder auch in einem Mitgliedstaat der EU befinden.
Die zuständige Behörde kann zur Unterstützung für die epidemiologischen Untersuchungen die Epidemiologische Beratungsgruppe des FLI anfordern32. Diese hat ja, durch den Zugriff auf die deutschlandweiten Daten von TSN und HIT, die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden, Sperrgebiete, Beobachtungs- und Impfgebiete über die Kreisebene hinaus festzulegen.
Der Landkreis beruft einen Krisenstab ein, dessen Mitglieder im Rahmen von Tierseuchenausbruchs- oder Katastrophenschutzübungen meist vorher schon festgelegt worden sind33,34a,35. Die Leitung hat in der Regel der Landrat.
Auf dem Gelände der Bundeswehr sind die entsprechenden Stabsveterinäre zuständig für die Kontrolle und Bekämpfung von Tierseuchenausbrüchen. Um hier einen reibungslosen Ablauf bei einem gebietsübergreifendem Seuchengeschehen (zivile Landkreise und militärische Gebiete) zu gewährleisten, gibt es schon seit Jahrzehnten entsprechende Übungen in der zivil-militärischen Zusammenarbeit. Auch das Technische Hilfswerk (THW) ist in diese Übungen eingebunden34b.
Für die Führung und Leitung im Einsatz ist im Katastrophenfall (dazu gehört ein Tierseuchenausbruch) die Feuerwehr zuständig gemäß der Dienstvorschrift 10036. Unter der Leitung der Feuerwehr werden Sachgebiete (S) eingerichtet: S1 Personal / Innerer Dienst - S2 Lage - S3 Einsatz (hier werden im Falle eines Tierseuchenausbruchs die veterinär(epidemiologischen) Kräfte gebündelt) - S4 Versorgung - S5 Presse- und Medienarbeit - S6 Informations- und Kommunikationswesen, sowie weitere Fachberater und Verbindungspersonen. Die Sachgebiete S5 und S6 vermitteln die Katastrophe (hier: den MKS-Ausbruch), ihr Entstehen, ihren Fortgang und die nötigen Schutzmaßnahmen an die Bevölkerung. Die Bedeutung dieser beiden Sachgebiete und der immense Schaden, der durch eine unzulängliche, angstmachende, böswillige Kommunikation voller Lügen und Panikmache angerichtet werden kann, hat uns die inszenierte Coronakrise mehr als deutlich vor Augen geführt. Nicht umsonst legen Deutschland und die EU seit Jahren und immer aggressiver einen Schwerpunkt auf Zensur und die Einschränkung der Meinungsfreiheit und der ungehinderten Information.
Gegen das Wohl und den freien Willen der Bevölkerung.
Ergeben die epidemiologischen Untersuchungen das Risiko eines Eintrags des MKS Virus in die Wildtierpopulation des Landkreises, in dem sich der Seuchenbetrieb befindet oder angrenzender Landkreise, so werden Jagdausübungsberechtigte in die Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung miteinbezogen20.
Weiterhin wird, ausgehend von den Ergebnissen der epidemiologischen Untersuchungen (tracing back und tracing forward), um den Sperrbezirk ein Beobachtungsgebiet gelegt (hier wird wieder die geographische Lage der in TSN registrierten Betriebe als Grundlage herangezogen). Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet zusammen müssen mindestens einen Radius von 10 km aufweisen. Im Sperrbezirk und im Beobachtungsgebiet werden alle Tiere empfänglicher Arten gezählt, abgesondert und von amtlich bestellten Tierärzten untersucht. Sie dürfen nicht aus dem Betrieb verbracht werden. Auch gelten Verbringungs- und Handelsverbote für sämtliche tierischen Produkte, einschließlich Milch. Ausnahmen sind nach behördlicher Maßgabe möglich37.
Tiere, für die der Nachweis einer MKS-Infektion erbracht wurde, sowie sämtliche empfänglichen Tiere des jeweiligen Seuchenbetriebes, werden auf behördliche Anordnung getötet. Ihre tierischen Produkte werden - wie oben beschrieben - unschädlich beseitigt.
Die MKS Verordnung macht konkrete Vorgaben bezüglich der Anforderungen, auch zeitlicher Art, die ein Seuchenbetrieb erfüllen muß, bis er wieder einen Tierbestand empfänglicher Arten einstallen darf20.
Zusammenfassend wird deutlich, daß ein MKS-Ausbruch sowohl eine drastische Einschränkung des Personen-, Tier- und Fahrzeugverkehrs (Lockdown…) als auch eine umfassende Vernichtung tierischer Lebensmittel (Fleisch, Milch) nach sich zieht. Wer also nicht freiwillig Insekten als neues Hauptnahrungsmittel akzeptiert, dem kann durch Tierseuchenausbrüche - amtlich angeordnet - sein Speiseplan vorgegeben werden.
„Ein Schelm … „und so…
Impfungen
Impfungen gegen die Maul- und Klauenseuche sind verboten20.
Heilversuche sind verboten20.
Bezüglich der Impfungen sind Ausnahmen jedoch wiederum möglich.
Dabei gibt es Abstufungen bezüglich der Zuständigkeiten:
Sofern Belange der Seuchenbekämpfung nicht entgegenstehen, kann die zuständige Behörde - also national - im Einzelfall Impfungen gegen MKS für wissenschaftliche Zwecke und Impfstoffprüfungen genehmigen20.
Notimpfungen (§ 16 - MKS-VO) zur Eindämmung der Maul- und Klauenseuche dürfen zwar ebenfalls von der zuständigen Behörde angeordnet werden, jedoch nur vorbehaltlich des Vorliegens einer Genehmigung der Europäischen Kommission - also nicht mehr national - für ein sogenanntes Impfgebiet20.
Hierzu hat die zuständige Behörde einen detaillierten Impfplan zu erstellen.
Dieser enthält u.a. detaillierte örtliche Vorgaben zum vorgesehenen Impfgebiet.
Notimpfungen sind auch möglich, um die Ausbreitung eines MKS-Ausbruches aus einem benachbarten Mitgliedstaat oder einem Drittland in einen Landkreis zu verhindern.
Die MKS-VO unterscheidet bei der Notimpfung zwischen einer Schutzimpfung und einer Suppressivimpfung.
Die Suppressivimpfung darf nur innerhalb des Sperrbezirkes durchgeführt werden und nur bei Tieren, für die die Tötung angeordnet worden ist.
Die Schutzimpfung soll die weitere Verbreitung des Virus möglichst verhindern und findet in einem angeordneten Impfgebiet statt.
Bei jeder Notimpfung legt die zuständige Behörde um das Impfgebiet / den Sperrbezirk ein Überwachungsgebiet fest, in welchem nicht geimpft werden darf und welches vom Rand des Impfgebietes mindestens eine Breite von 10 km aufweist. Tiere empfänglicher Arten dürfen nur nach vorheriger Anzeige bei der zuständigen Behörde in dieses Überwachungsgebiet verbracht werden20. Auch für tierische Erzeugnisse gibt es detaillierte Beschränkungen im Impf- und Überwachungsgebiet. Dieses Überwachungsgebiet gilt für mindestens 30 Tage nach der Impfung. Danach werden im Überwachungsgebiet amtliche Untersuchungen zur Feststellung des MKS-Virus durchgeführt.
Wenn die zuständige Behörde aus Gründen der Seuchenbekämpfung die Tötung empfänglicher Arten im Sperrbezirk, Beobachtungsgebiet oder Impfgebiet für nötig erachtet, so kann sie diese anordnen20.
Hat sich der Verdacht auf Maul- und Klauenseuche nicht bestätigt oder sind nach Überprüfung durch die zuständige Behörde die Bedingungen zur Wiederbelegung der Betriebe nach Seuchenausbruch erfüllt, so hebt die zuständige Behörde die Beschränkungen nach MKS-Verordnung wieder auf20.
Impfstoffe gegen die Maul- und Klauenseuche hält das FLI vorrätig.
Dies ist u.a auch historisch bedingt, da Friedrich Loeffler das erste Schutzserum gegen die Maul- und Klauenseuche herstellte12,38.
In der DDR gehörte die Impfung gegen MKS bei Rindern und Kleinen Wiederkäuern zur üblichen Immunprophylaxe und Bekämpfung1.
Die WOAH unterscheidet zwischen zwei Hauptgruppen, nämlich Länder frei von Maul- und Klauenseuche mit und ohne Impfung21,39.
Aufgrund des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg im Januar 2025 hat Deutschland seinen Status „Frei von Maul- und Klauenseuche ohne Impfung“ verloren39+Karte.
Zu dem in einer Impfbank vorgehaltenen MKS-Impfstoffen für Deutschland schreibt das FLI in seinen „FAQ Impfung gegen Maul- und Klauenseuche“:
„Deutschland hat für den Fall eines MKS-Ausbruchs eine Impfbank bzw. Antigenbank eingerichtet, finanziert von den Bundesländern. Dort lagern tiefgekühlt konzentrierte Mengen von abgetöteten MKS-Viren aller häufigen Serotypen. Aus diesen Konzentraten und einem Wirkverstärker (Adjuvanz) werden bei Aktivierung der Bank gebrauchsfertige Flüssigimpfstoffe hergestellt, abgefüllt und an die Länder ausgeliefert. …
Die Antigenbank kann nach Aktivierung durch die Bundesländer benötigte Impfstoffe innerhalb einer Woche herstellen.“38.
Diese Impfstoffe verhindern laut FLI jedoch keine Infektion, sondern schützen lediglich vor klinischer Erkrankung und führen zu einer reduzierten Ausscheidung des Virus38.
Wenn dem tatsächlich so ist, mag dies der Grund für die in der MKS-VO ermöglichten Suppressivimpfung sein, im Falle, daß Bestsände nicht sofort gekeult und unschädlich beseitigt werden können20.
In diesem Rahmen besetzt das FLI nun in Kooperation mit dem US-Landwirtschafts-ministerium die Stelle eines Wissenschaftlichen Mitarbeiters mit folgenden Anforderungen40,41:
„Die Maul- und Klauenseuche (MKS) ist eine hochansteckende Viruserkrankung der Paarhufer. Sie ist weltweit eine der größten Bedrohungen für die Erzeugung und den Handel mit tierischen Produkten. Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber wird Forschungsaufgaben im Rahmen eines gemeinsamen Projektes mit dem US-Landwirtschaftsministerium zur MKS übernehmen. Dabei wird die Virusevolution im Wirt, insbesondere die Entstehung, Evolution und Übertragung von Virusrekombinanten in verschiedenen Wirtsspezies, untersucht. Die Rekombination ist von großer Bedeutung für die Virusdiversität und ihr besseres Verständnis kann einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der MKS leisten.
Aufgaben:
• Bioinformatische Aufbereitung und Auswertung von Next-Generation-Sequencing (NGS) Daten
• Etablierung und Weiterentwicklung einer Pipeline zur Detektion und Quantifizierung von MKS-Virus-Varianten (Quasispezies)
• Identifikation und Charakterisierung von rekombinanten MKS-Viren
• Bearbeitung von Tierversuchsproben im Labor mit molekularbiologischen Methoden
• In-vitro Rekombinationsexperimente mit gentechnisch veränderten MKS Viren
• Erhebung, Auswertung und Kommunikation wissenschaftlicher Daten in Berichten,
Konferenzen und Publikationen“41.
Beinahe fühlt man sich erinnert an lange geleugnete ‚gain-of-function‘ Versuche in einem Labor in China…
Passend dazu und nachdem die modRNA (modifizierte RNA) erstmals am Menschen getestet wurde…, legt die EMA (European Medicines Agency - Europäische Arzneimittelbehörde) nun auch in einem mehrmonatigen Prozeß Standards für modRNA-Impfstoffe in der Tiermedizin fest42.
Hier müssen wir uns deutlich und im Sinne des so vielzitierten Tierwohles äußern!
Ansonsten ist die Katastrophe vorprogrammiert.
Claudia Schoene
Tierärztin
Quellen
1. Beer J. & G. Thalmann. 1.1. Maul- und Klauenseuche. 1987. In Beer, J. (Hrsg.) Infektionskrankheiten der Haustiere. 3. überarbeitete und erweiterte Auflage. Teil I Viruskrankheiten, Chlamydien-Infektionen, Rickettsiosen, Anaplasmosen. VEB Gustav Fischer Verlag Jena. S. 15 - 39.
2. https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/maul-und-klauenseuche/. Abgerufen am 16. Februar 2025.
3. https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/002-MKS.html. Abgerufen am 16. Februar 2025.
4. https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_fmd.htm. Abgerufen am 16. Februar 2025.
5. https://www.woah.org/en/disease/foot-and-mouth-disease/. Abgerufen am 16. Februar 2025
6. https://www.fao.org/eufmd/global-situation/about-the-disease/en/. Abgerufen am 16. Februar 2025.
7. https://tierseucheninfo.niedersachsen.de/startseite/tierseuchen_tierkrankheiten/schwein/
maul_und_klauenseuche/maul_und_klauenseuche/haeufig-gestellte-fragen-zu-maul-und-klauenseuche-21689.html. Abgerufen am 16. Februar 2025.
8. https://www.wrlfmd.org/country-reports. Abgerufen am 26. Februar 2025.
9. https://www.wrlfmd.org/foot-and-mouth-disease/occurrence. Abgerufen am 26. Februar 2025.
10. https://www.wrlfmd.org/. Abgerufen am 26. Februar 2025.
11. https://wahis.woah.org/#/event-management. Filter: „Foot-and-Mouth Disease. Abgerufen am 16. Februar 2025.
12. https://www.fli.de/de/ueber-das-fli/friedrich-loeffler/.
13. https://www.rki.de/DE/Institut/Das-RKI/das-rki-node.html.
14. https://www.fli.de/de/ueber-das-fli/das-fli/.
15. https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/maul-und-klauenseuche/.
16. Knaur. Das deutsche Wörterbuch A - Z. 1985. Erarbeitet von Ursula Hermann unter Mitarbeit von Horst Leisering und Heinz Hellerer. Lexikographisches Institut, München. C.H. Beck’sche Buchdruckerei, Nördlingen. S. 140.
17. Plewig, G., M. Landthaler, W. Burgdorf, M. Hertl & T. Ruzicka (Hrsg.). 2015. Braun-Falco’s Dermatologie, Venerologie und Allergologie. 6. Auflage. Springer Verlag GmbH. Berlin. S. 1329.
18. https://eufmdlearning.works/mod/data/view.php?id=472. Abgerufen am 26. Februar 2025.
19. https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/002-MKS.html. Abgerufen am 02. März 2025.
20. https://www.gesetze-im-internet.de/mkseuchv_2005/MKSeuchV_2005.pdf. Abgerufen am 16. Februar 2025.
21. https://www.woah.org/en/disease/foot-and-mouth-disease/#ui-id-2. Abgerufen am 02. März 2025.
22. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0429. Abgerufen am 16. Februar 2025.
23. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02020R0687-20230503. Abgerufen am 16. Februar 2025.
24. https://www.gesetze-im-internet.de/tiergesg/TierGesG.pdf. Abgerufen am 16. Februar 2025.
25. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500087. Abgerufen am 16. Februar 2025.
26. https://www.woah.org/en/who-we-are/. Abgerufen am 16. Februar 2025.
27. https://www.woah.org/en/who-we-are/structure/framework/basic-texts/international-agreement-for-the-creation-of-an-office-international-des-epizooties/. Abgerufen am 16. Februar 2025.
28. https://www.fli.de/de/institute/institut-fuer-epidemiologie-ife/arbeitsgruppen/tierseuchen-nachrichtensystem-tsn/. Abgerufen am 02. März 2025.
29. https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/das-europalexikon/177162/nuts/. Abgerufen am 02. März 2025.
30. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Landkreise_in_Deutschland. Abgerufen am 02. März 2025.
31. https://www.hi-tier.de/. Abgerufen am 02. März 2025.
32. https://www.fli.de/de/institute/institut-fuer-epidemiologie-ife/arbeitsgruppen/
epidemiologische-beratungsgruppe/. Abgerufen am 02. März 2025.
33. https://www.bbk.bund.de/DE/Themen/Akademie-BABZ/akademie-babz_node.html. Abgerufen am 02. März 2025.
34a. https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BABZ/babz-jahresprogramm-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=2. S. 129-140. Abgerufen am 02. März 2025.
34b. https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BABZ/babz-jahresprogramm-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=2. S. 141-147. Abgerufen am 09. März 2025.
35. https://www.bmel.de/DE/themen/tiere/tiergesundheit/tierseuchen/mks.html. Abgerufen am 02. März 2025.
36. https://www.idf.nrw.de/dokumente/wir-ueber-uns/aufgaben-des-idf/fwdv100.pdf. Abgerufen am 28. Februar 2025.
37. https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate
_00063896/FLI-Risikoeinschaetzung_MKS_2025-01-23.pdf. Abgerufen am 02. März 2025.
38. https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00063742/
FLI-FAQ_MKS_2025-01-17_bf.pdf. Abgerufen am 02. März 2025.
39. https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination. Abgerufen am 02. März 2025.
40. https://peds-ansichten.de/2025/02/maul-und-klauenseuche-fli-plandemie-pcr-test-landwirtschaft-tierquaelerei/. Abgerufen am 02. März 2025.
41. https://www.fli.de/fileadmin/FLI/Stellenausschreibungen/2024/Quartal_4/130-24_de.pdf. Abgerufen am 02. März 2025.
42. https://uncutnews.ch/nachdem-es-an-menschen-getestet-wurde-legt-ema-erstmals-standards-fuer-mrna-impfstoffe-in-der-veterinaermedizin-fest/. Abgerufen am 03. März 2025.








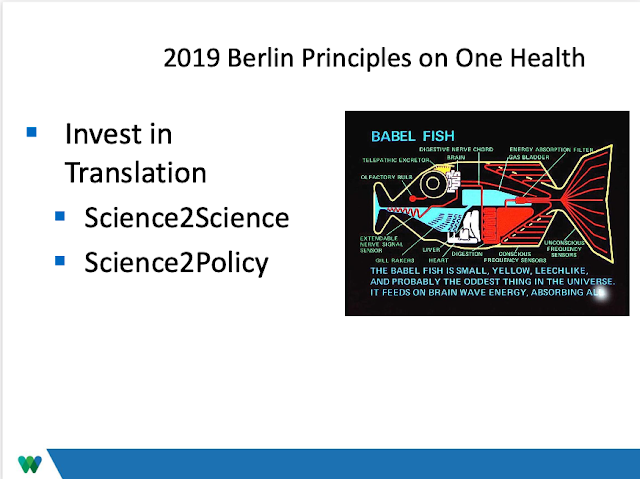




















WM-1.jpg)

